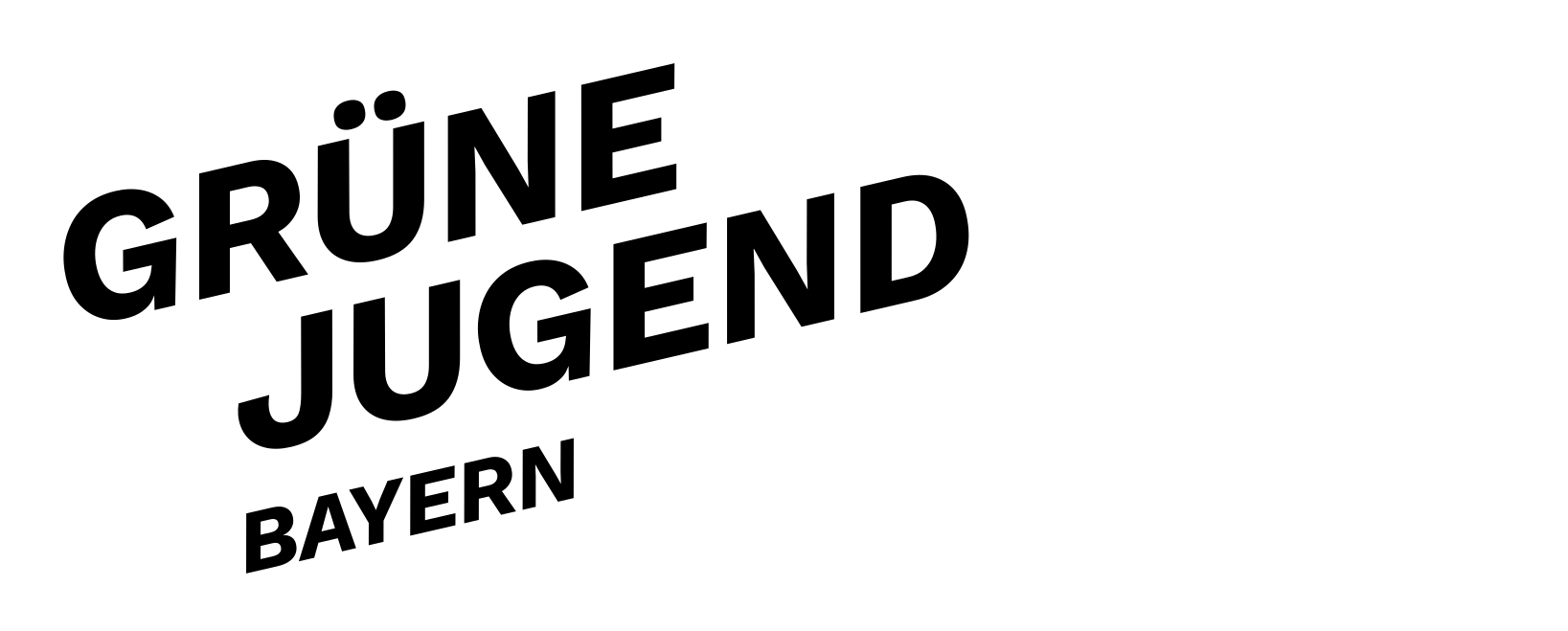| Veranstaltung: | 55. Landesjugendkongress |
|---|---|
| Tagesordnungspunkt: | TOP 7 Anträge |
| Antragsteller*in: | Dex Mareyen (KV Mühldorf), Christian Geiger (BZV Ostbayern), Laetitia Wegmann (KV Erding), Fabie Schuster (KV Ingolstadt), Elena Geiger (KV Oberland), Moritz Kunisch (KV Ebersberg), Susan Schnitter (KV Mühldorf), Melina Reischl (KV Mühldorf), Anna Wirnhier (KV Mühldorf), Hannes Deimer (KV Erding) |
| Status: | Eingereicht |
| Verfahrensvorschlag: | Abstimmung (Angenommen) |
| Angelegt: | 24.04.2025, 23:54 |
X4: Geldwäsche? Nicht mit uns!
Antragstext
Die Versammlung möge beschließen:
1. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert den Bundesverband der GRÜNEN JUGEND auf, sich
für die Einführung einer nationalen Bargeldobergrenze in Höhe von 1.000 Euro für
Zahlungen zwischen Privatpersonen, zwischen Privatpersonen und Unternehmen sowie
zwischen Unternehmen einzusetzen.
Für Zahlungen jenseits der genannten Grenze müssen sich die beteiligten
Akteur*innen ausweisen sowie die Herkunft der Mittel offenlegen.
2. Die GRÜNE JUGEND Bayern fordert die bayerische Landesregierung auf, sich auf
Bundesebene für eine entsprechende gesetzliche Regelung einzusetzen.
Begründung
Die Europäische Union hat im Jahr 2023 eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro beschlossen, die ab 2028 in allen Mitgliedsstaaten gelten soll. Diese Obergrenze ist jedoch deutlich zu hoch angesetzt, um wirksam gegen Geldwäsche, Steuerhinterziehung und Terrorismusfinanzierung vorzugehen. Eine Bargeldobergrenze von 10.000 Euro erfasst lediglich einen sehr kleinen Teil problematischer Transaktionen und lässt erhebliche Schlupflöcher für illegale Finanzströme. Zudem gilt sie nur für gewerbliche Transaktionen, wodurch informelle Geschäfte zwischen Privatpersonen weiterhin in unbegrenzer Höhe möglich sein werden.
Eine nationale Bargeldobergrenze von 1.000 Euro würde hingegen einen effektiven Beitrag zur Bekämpfung von Finanzkriminalität leisten. Deutschland ist laut Studien der Europäischen Kommission und des Bundeskriminalamts ein Hotspot für Geldwäsche in Europa. Jährlich werden in Deutschland schätzungsweise 100 Milliarden Euro an illegalen Geldern gewaschen. Besonders der Immobiliensektor und der Handel mit Luxusgütern sind davon betroffen.
Der Eingriff in die Freiheit der Bürgerinnen und Bürger, mit Bargeld zu zahlen, ist angesichts der gravierenden gesellschaftlichen Schäden durch Steuerhinterziehung und Geldwäsche verhältnismäßig. Dem deutschen Staat entgehen jährlich Steuereinnahmen in Milliardenhöhe, die für wichtige öffentliche Aufgaben wie Bildung, Klimaschutz und soziale Sicherung fehlen; zudem wird durch Geldwäsche die organisierte Kriminalität gestärkt.
Die Bargeldobergrenze schränkt nicht die Möglichkeit ein, Bargeld zu besitzen oder kleinere Beträge bar zu bezahlen. Für den alltäglichen Gebrauch bleibt Bargeld uneingeschränkt nutzbar.
Auch können Beträge jenseits der Grenze nach wie vor bar bezahlt werden, wenn sich die beteiligten Akteur*innen ausweisen und die Herkunft der Mittel offenlegen. Zudem sind heute digitale Zahlungsmethoden flächendeckend verfügbar und für nahezu alle Bevölkerungsgruppen zugänglich.
Fast alle anderen europäischen Länder haben bereits niedrigere Bargeldobergrenzen eingeführt und positive Erfahrungen damit gemacht:
- Frankreich: 1.000 Euro
- Spanien: 1.000 Euro für Inländer, 10.000 Euro für Ausländer
- Italien: 5.000 Euro
- Portugal: 1.000 Euro für Inländer, 10.000 Euro für Ausländer
- Griechenland: 500 Euro
- Belgien: 3.000 Euro zwischen Privatpersonen und Unternehmen, vollständiges Verbot für Immobiliengeschäfte
- Bulgarien: ca. 5.100 Euro
- Dänemark: ca. 2.000 Euro zwischen Privatpersonen und Unternehmen
- Kroatien: ca. 10.000 Euro
- Lettland: ca. 7.000 Euro
- Litauen: 5.000 Euro
- Niederlande: 3.000 Euro geplant
- Norwegen: ca. 4.000 Euro zwischen Privatpersonen und Unternehmen
- Rumänien: ca. 2.000 Euro
- Slowenien: 5.000 Euro
Kaum eingeschränkter Barzahlungsverkehr führt nachweislich zu einer Stärkung von Steuerhinterziehung und organisierter Kriminalität (https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2021-0649/QEF_649_21.pdf).
Eine Bargeldobergrenze von 1.000 Euro stellt einen ausgewogenen Kompromiss zwischen dem legitimen Interesse an Bargeldnutzung für alltägliche Transaktionen und dem gesellschaftlichen Interesse an der Bekämpfung von Finanzkriminalität dar. Zahlungen jenseits der genannten Grenze sind, sofern sich die beteiligten Akteur*innen ausweisen sowie die Herkunft der Mittel offenlegen, grundsätzlich auch weiterhin möglich. Eine Obergrenze für Bargeld würde Deutschland auf das Niveau anderer fortschrittlicher europäischer Länder bringen und einen wichtigen Beitrag zu mehr Steuergerechtigkeit und weniger Kriminalität leisten.