Die Deckelung von Erbschaften, z.B. auf 10 Millionen Euro, ist aus drei Gründen abzulehnen.
- Praktikabilität: Reiche Personen könnten ihr Vermögen leicht auf verschiedene Wege verteilen – etwa durch Schenkungen zu Lebzeiten, Familienstiftungen, Trusts oder internationale Vermögensstrukturen. Eine effektive Kontrolle und Bewertung all dieser Vermögensformen wäre extrem aufwendig und fehleranfällig.
- Wirtschaftliche Nebenwirkungen: Eine feste Obergrenze, speziell eine so niedrige wie 10 Millionen Euro, würde zwangsläufig Familienunternehmen oder mittelständische Betriebe gefährden, wenn diese nach einem Erbfall zerschlagen oder verkauft werden müssten, um die Deckelung einzuhalten. Das würde Arbeitsplätze und langfristige Investitionen gefährden.
- Verfassungswidrigkeit: Das Grundgesetz schützt das Eigentum und gewährleistet das Erbrecht (Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG). Der Staat darf zwar Inhalt und Schranken des Erbrechts bestimmen (Art. 14 Abs. 1 S. 2 GG), muss dabei aber den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit wahren (Art. 20 Abs. 3 GG). Eine starre Obergrenze von 10 Millionen Euro genügt diesen Anforderungen nicht. Die Obergrenze hilft zwar, Vermögensungleichheit zu reduzieren und soziale Gerechtigkeit zu stärken. Gleichwohl gäbe es mildere und ähnliche effektive Mittel wie höhere Erbschaftssteuern. Eine starre Grenze wäre ein massiver Eingriff in Art. 14 Abs. 1 S. 1 GG, der auch vor den Hintergrund der Unpraktikabilität (1.) und Nebenwirkungen (2.) nicht gerechtfertigt werden kann.
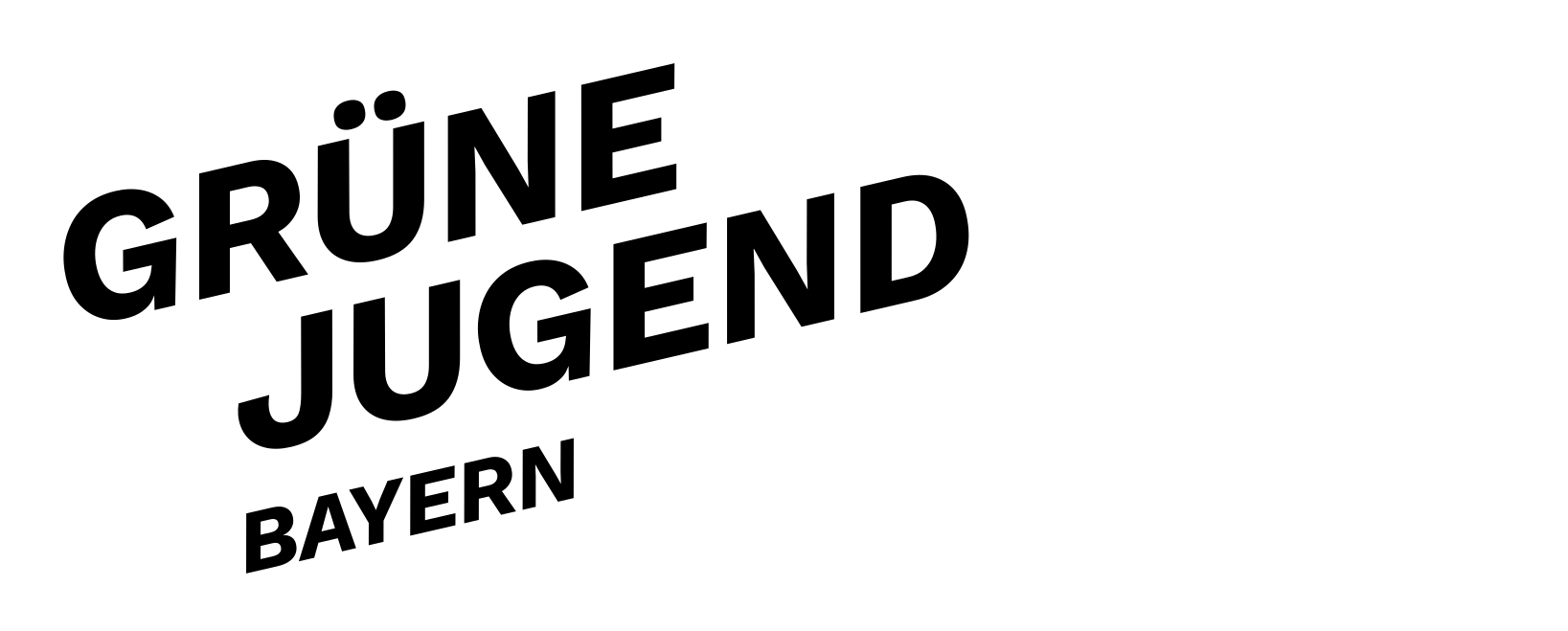
Kommentare