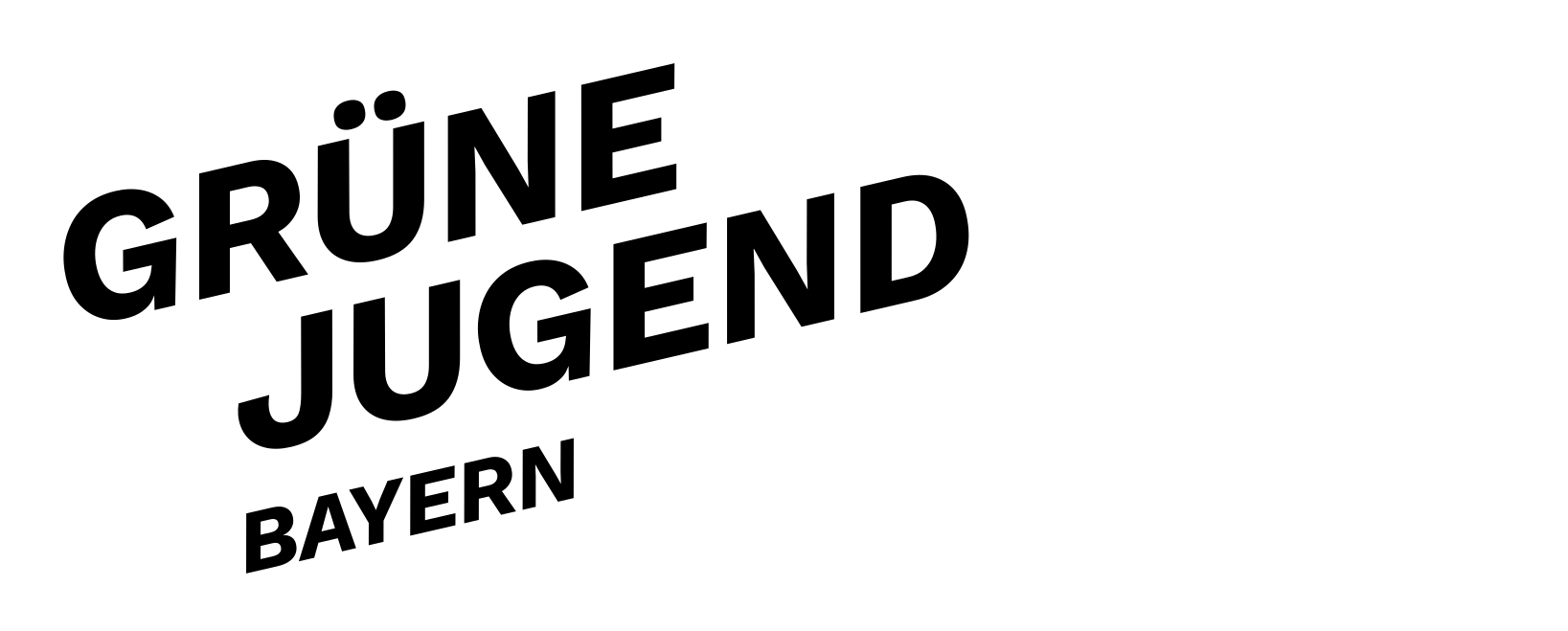Triggerwarnung Tierleid
TLDR:
Tiere werden in unserer Gesellschaft systematisch ausgebeutet und leiden in der industriellen Tierhaltung.
Sie leben auf engstem Raum, sehen kein Tageslicht und sterben unter grausamen Bedingungen.
Tiere werden wie Produkte behandelt, nicht wie fühlende Lebewesen.
Die Tierhaltung trägt erheblich zur Klimakrise bei und zerstört Wälder und Lebensräume.
Auch die Ozeane sind betroffen: Überfischung vernichtet Arten und zerstört Meeresökosysteme.
Schleppnetze reißen Korallenriffe ein und töten viele Tiere als Beifang.
Durch Massentierhaltung entstehen neue Krankheiten und Pandemierisiken.
Der Welthunger verschärft sich, weil riesige Flächen für Tierfutter statt für Nahrung genutzt werden.
Auch Arbeiter*innen in Schlachthöfen und Tierbetrieben leiden unter psychischen Belastungen.
Als Grüne Jugend brauchen wir hierzu mehr Bildungsarbeit, um dieses Thema angemessen angehen zu können.
Kurzform in einfacher Sprache:
In unserem Land werden viele Tiere schlecht behandelt.
Sie leben oft auf engem Raum und sehen kein Tageslicht.
Viele Tiere leiden und sterben für Fleisch, Milch oder Eier.
Das ist nicht nur schlecht für die Tiere.
Auch die Natur leidet darunter.
Tierhaltung macht viele Treibhausgase.
Dadurch wird die Erde wärmer.
Auch im Meer gibt es Probleme.
Menschen fangen zu viele Fische.
Viele Tierarten im Meer sterben aus.
Netze zerstören den Boden im Meer.
Wenn Menschen Tiere schlecht behandeln,
können auch neue Krankheiten entstehen.
Und es gibt mehr Hunger auf der Welt,
weil viele Pflanzen für Tierfutter gebraucht werden.
Auch die Menschen, die mit Tieren arbeiten,
leiden oft unter dem, was sie tun müssen.
Darum sagt die Grüne Jugend:.
Wir müssen sie schützen.
Dafür brauchen wir bessere Bildung dazu.
Lange Form:
Im Kampf gegen Unterdrückung und Ausbeutung haben wir als Verband bislang eine Gruppe systematisch vernachlässigt:
Die Tiere. Es wird Zeit, dem Thema endlich den nötigen Stellenwert einzuräumen
Das Ausmaß des Tierleids in unserer Gesellschaft ist erschütternd: Allein in Deutschland werden jährlich etwa 750 Millionen Tiere – das sind mehr als 2 Millionen täglich – für den menschlichen Konsum getötet. Die Bedingungen, unter denen diese Tiere leben müssen, sind in den meisten Fällen grausam: Sie stehen auf engstem Raum, sehen oft kein Tageslicht und verbringen ihr kurzes Leben inmitten ihrer eigenen Exkremente und dem Kadaver ihrer Artgenossen. Für viele dieser Tiere ist der Transport zum Schlachthof der erste und einzige Moment, in dem sie Tageslicht erblicken.
Mit Tieren wird umgegangen, als seien sie Dinge, nicht fühlende Lebewesen. Heutige "Nutztiere" werden als "Produkte" für einen "Verwendungszweck" gezüchtet. Sie werden bei lebendigem Leib verstümmelt – Schweine, Rinder, Hühner und Ziegen werden routinemäßig kastriert, enthornt, ihre Ohren werden verstümmelt und ihnen werden Ringe durch die Nasen gestochen. Fische und andere Meerestiere ersticken qualvoll in den Kuttern oder Zuchtbetrieben. Ein qualvoller Tod im Schlachthof markiert das schreckliche Ende im Leben von Nutztieren, die nicht vorher schon durch Krankheiten oder Erschöpfung verendet sind: Betäubungen funktionieren häufig nicht oder lösen selbst Qualen aus, beim vollem Bewusstsein wird ihnen kopfüber hängend die Kehle aufgeschlitzt oder ein Bolzenschuss falsch gesetzt – jeden Tag, in Deutschland, auch beim Bio-Hof nebenan.
Die industrielle Tierhaltung ist jedoch nicht nur ein ethisches Problem, sondern steht in direktem Zusammenhang mit zahlreichen anderen Krisen unserer Zeit:
Die Klimakrise wird durch die Tierhaltung massiv verschärft. Laut FAO ist die Tierhaltung für etwa 14,5% der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich – mehr als der gesamte Transportsektor. Methan aus der Rinderhaltung, Lachgas aus Gülle und CO2 aus der Rodung von Wäldern für Futtermittelanbau tragen erheblich zur Erderhitzung bei.
Auch unsere Ozeane sind von massiver Ausbeutung betroffen. Überfischung zerstört nicht nur marine Ökosysteme, sondern bedroht das Überleben ganzer Arten und die Stabilität des globalen Klimas. Riesige Fangflotten plündern die Meere, häufig mit Methoden wie Schleppnetzen, die den Meeresboden verwüsten und Korallenriffe vernichten. Lebensräume, die für Millionen Meereslebewesen überlebenswichtig sind. Viele Fischbestände sind bereits kollabiert oder stehen kurz davor. Gleichzeitig werden zahllose nicht-zielgerichtete Tiere wie Delfine, Schildkröten und Seevögel als Beifang getötet. Die Zerstörung der marinen Nahrungsketten führt zu einem empfindlichen Ungleichgewicht in den Ökosystemen, während die industrielle Aquakultur neue Probleme schafft: von der Verschmutzung der Gewässer über den Einsatz von Antibiotika bis hin zum immensen Druck auf wild gefangene Futterfische. Auch hier zeigt sich: Die kapitalistische Logik der grenzenlosen Ausbeutung macht selbst vor den Tiefen der Meere nicht halt.
Der Welthunger wird durch die ineffiziente Nutzung von Ressourcen in der Tierhaltung verschärft. Um ein Kilogramm Fleisch zu produzieren, werden je nach Tierart bis zu 16 Kilogramm pflanzliches Protein verfüttert.
Etwa 70% der landwirtschaftlichen Nutzfläche weltweit werden für die Tierhaltung verwendet – entweder direkt als Weideland oder indirekt für den Anbau von Futtermitteln.
Für Weideland und den Anbau von Futtermitteln werden Wälder gerodet und natürliche Lebensräume zerstört. Besonders dramatisch ist die Situation in Regionen wie dem Amazonas, wo Regenwald für Rinderweiden und Sojaplantagen weichen muss.
Auf den landwirtschaftlichen Flächen, die derzeit für den Anbau von Tierfutter genutzt werden, könnten direkt Nahrungsmittel für Menschen angebaut werden.
Auch Pandemien stehen in engem Zusammenhang mit unserem Umgang mit Tieren. Die meisten neuen Infektionskrankheiten sind Zoonosen – sie springen von Tieren auf Menschen über. Die industrielle Tierhaltung mit ihrer hohen Besatzdichte, dem Einsatz von Antibiotika und der genetischen Vereinheitlichung der Tierbestände schafft ideale Bedingungen für die Entstehung und Verbreitung neuer Krankheitserreger.
Nicht zuletzt ist die Tierhaltung auch ein Problem des Arbeitnehmer*innenschutzes. Tierärzt*innen sind die Berufsgruppe mit der höchsten Suizidrate. Schlachthofarbeitende weisen auffällig hohe Raten an depressiven Symptomen, Suiziden, Angstzuständen, Alkoholismus, Drogenabhängigkeit und posttraumatischen Belastungsstörungen auf. Viele leiden unter dem sogenannten "perpetrator induced traumatic syndrome" – einem Trauma, das durch selbst begangene Gräueltaten ausgelöst wird.
In der Vergangenheit haben wir als Grüne Jugend das Thema Tierrechte oft unsachlich behandelt oder es ganz vermieden. Es ist an der Zeit, dass wir uns ernsthaft mit dem Thema auseinandersetzen und es in unser politisches Handeln integrieren.
Quellen:
- Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft: Statistik zur Schlachtung und Fleischerzeugung 2022
- FAO (2013): Tackling Climate Change Through Livestock
- WHO (2020): Report on Zoonotic Diseases and Public Health
- Heinrich-Böll-Stiftung (2021): Fleischatlas – Daten und Fakten über Tiere als Nahrungsmittel
- Fitzgerald, A. J., et al. (2009): Slaughterhouses and Increased Crime Rates: An Empirical Analysis of the Spillover From "The Jungle" Into the Surrounding Community
- Leibler, J. H., et al. (2017): Industrial Food Animal Production and Community Health
- Offizieller Bericht der Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der Vereinten Nationen: https://www.fao.org/publications/sofia/en/
- IPBES (2019): Global Assessment Report on Biodiversity and Ecosystem Services: https://www.ipbes.net/global-assessment
- WWF (2020): Living Planet Report – Focus Oceans: https://www.wwf.de/living-planet-report
- Greenpeace (2021): Überfischung der Weltmeere – Ursachen, Folgen, Lösungen: https://www.greenpeace.de/themen/meere/ueberfischung
- European Environment Agency (EEA, 2023): Marine environment and fisheries in Europe: https://www.eea.europa.eu/
- Marine Stewardship Council (MSC, 2021): Sustainable Fisheries and Bycatch Reduction: https://www.msc.org/
- Science (Pauly et al., 2002): Towards sustainability in world fisheries: DOI: 10.1126/science.1070889
- UNEP (2021): Environmental Impacts of Aquaculture: https://www.unep.org/resources/report/environmental-impacts-aquaculture
- FAO (2020): The State of World Aquatic Genetic Resources for Food and Agriculture: https://www.fao.org/aquatic-genetic-resources/en/